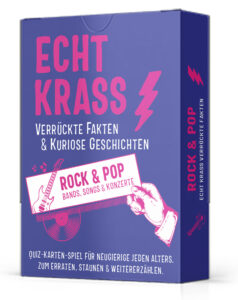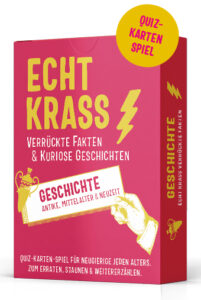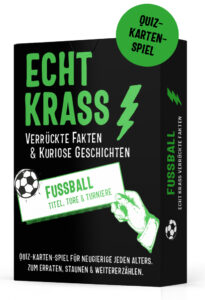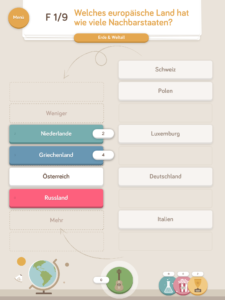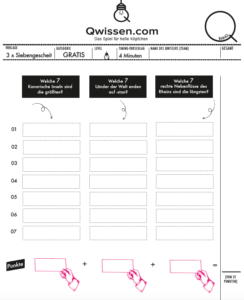Liste ≡ Kunstepochen
20 Kunstepochen der Malerei & Literatur
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Kennzeichen aller Kunstepochen in der Geschichte.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
| Kunstepochen (Entstehung) | Kunstepochen (Bedeutung) | Kennzeichen in der Malerei (Vertreter) | Kennzeichen in der Literatur (Vertreter) | Kennzeichen in der Architektur (Bauwerke) |
|---|---|---|---|---|
| Romanik (um 1000-1140 in der Normandie, F) |
Der Begriff Romanesque (in Anlehnung an die römische Architektur) wurde erst 1818 vom Franzosen Charles de Gerville geprägt In D ist er auch als Rundbogenstil bekannt. Die Romanik wurde im 13. Jahrhundert von der Gotik abgelöst. | Buchmalereien, Plastiken und Wandmalereien zeigen meist kirchliche (Heilige & Päpste), weltliche (Kaiser & Könige) oder drastische Motive (z.B. der Braunschweiger Löwe). Sie zeichnen sich – weil zu jener Zeit kaum jemand lesen konnte – durch hohen Symbolismus aus. Man unterscheidet nach den Kunstepochen Früh-, Hoch-, Spät- und Neuromanik. | In der Literatur findet diese Kunstepoche keine klare Unterscheidung. | Typische Merkmale der romanischen Baukunst sind gedrungene Rundbögen hinter dicken, schweren Mauern mit kleinen Fenstern. Beste Beispiele sind Kirchen mit Tonnen- oder Kreuzgratgewölben (Sacré-Cœur in Paray-le-Monial, Braunschweiger Dom) |
| Gotik (um 1200 in Frankreich) |
Ursprünglich als „opus francigenum“, später als Spitzbogenstil und in England als „Early English“ bezeichnet. Der Begriff Gotik wurde vom Italiener Giorgio Vasari geprägt und bedeutete „fremdartig, barbarisch“. | In der Malerei und Bildhauerei ist der gotische Stil nur schwer abzugrenzen. Man unterscheidet die Gotik nach den Kunstepochen Früh-, Spät- und Hochgotik. | In der Literatur findet diese Kunstepoche keine klare Unterscheidung. | Die Gotik entwickelte sich aus der Romanik (1000-1140) heraus. Typische Merkmale der gotischen Bauten sind hohe Kirchen mit Spitzbögen und Rippengewölben, oft mit kreisrunden Rosettenfenster verziert. (Kölner Dom, Regensburger Dom, Notre-Dame de Reims, Veitsdom in Prag) |
| Renaissance (1420-1530 in Italien) |
Aus dem französischen für „Wiedergeburt“. Bewusstwerden der Persönlichkeit, Motive sind vorwiegend religiöse Themen. | Mit der Entwicklung und Anwendung der dreidimensionalen Raumperspektive heben sich die Figuren im Zentrum des Gemäldes stark hervor. Gesichter werden individueller, wirken lebendiger und weicher (Mona Lisa). Auch die Kleidung findet größere Beachtung und wird in kräftigen Farben mit Falten etc. dargestellt. (Raffael, Da Vinci, Michelangelo) | Antike Literaturformen wie Epos, Satire, Lyrik wurden neu belebt. Die Volkssprache wurde dabei entdeckt. (Dante, Boccaccio) | Horizontale Flächen, oft mit Säulenhöfen und großen, hallenartigen Sälen; Ausdruck eines gehobenen Stolzes und Machtgefühls. (Florentiner Dom; St. Petersdom) |
| Barock (1590-1760 in ganz Europa) |
Vom portugiesischen „barucca“ steht die Bezeichnung für unregelmäßig geformte Perlen. Die Wurzeln des Barocks liegen in Italien. Der Kunststil entstand mit dem Wunsch nach Einfachheit und Klarheit. | Mit satten Farben und kräftigere Schwere findet die „Augentäuscherei“ Einzug in die Malerei: Die Macht wird verherrlicht. Fürsten, Könige und Päpste finden Gefallen daran, prunkvoll, pathetisch und theatralisch in Szene gesetzt oder auch in Gruppenszenerien dargestellt zu werden. In der Bildhauerei sind Gold und Marmor die vorherrschenden Materialien. (Brüder Carracci, Rembrandt, Rubens) | Kennzeichnend ist der Hang zur Übersteigerung und übertriebener Bildhaftigkeit (Grimmelshausen mit „Abentheuerl. Simplicissimus Teutsch“). | Von Parks umgebene Schlösser, lichtdurchflutete Räume, schraubenförmig gedrehte Säulen, pompöse Wandgemälde, Spiegelsäle (Schloss von Versailles). |
| Rokoko (1720-1780 in Frankreich) |
Der Begriff leitet sich von „rocaille“ (Grotten- und Muschelwerk) ab. Aus dem pompösen und „schweren“ Barock kommend, löst sich mit dem Rokoko alles in Licht, Luft, Lust und Leichtigkeit auf. Kunsthistoriker verwenden auch den Begriff „Spätbarock“. | Parklandschaften und ländliche Feste mit vornehm gekleideten Herrschaften: Diese sog. „Schäferidylle“ wird zum Ausdruck der Rokoko-Epoche. Musizierende und tanzende Gestalten werden zum Sinnbild einer unbeschwerten Heiterkeit, einer heilen Welt – mit dem Ziel, von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zwängen abzulenken. (J.A. Watteau, Rubens und Tizian). | Aufklärung: (1720-1800): Schriften und Fabeln über bürgerliches Leben zum selbständigen Denken. (Rousseau, Kant, Leibniz) | Reichliche Verzierungen und gewundene Linien an Bauten und Räumen; Verzicht auf Symmetrie (Schloss Solitude, Stuttgart, Schönbrunn, Wien). |
| Klassizismus (1770-1840 in Europa und Nordamerika) |
Napoleons Hofmaler J. L. David (1748-1825) gilt als Begründer des Klassizismus. In der Epoche blicken Künstler und Architekten zurück in die Vergangenheit und verwenden frühere Motive, Techniken und Formen. Epochen wie Biedermeier, Directoire, Empire und Louis-Seize gehören dazu. |
Historienbilder (oft mit griechischen und römischen Motiven) werden in kühlen Farben dargestellt. Porträtzeichnungen und Frauenakte werden mit akribischer Genauigkeit gezeichnet. (J. L. David und J.A.D. Ingres, A. R. Mengs) | Sturm & Drang: (1767-1785). Das Drama als erzieherische und bildende Form; vor allem von jungen Autoren wie Goethe, Schiller, Klinger. | Biedermeier: (1815-1845). Wiederaufleben des griech.-römischen Stils; Gebäude sind kräftig, streng und zurückhaltend. (Brandenburger Tor; Capitol in Washington). |
| Romantik (1795-1830 in Frankreich und Deutschland) |
Gegenbewegung zum Rationalismus. Phantasie und ein individuelles, gefühlsbetontes Naturerlebnis wird zur zentralen künstlerischen Aussage. | Bilder bestechen durch Farbigkeit und Dramatik, in denen Freiheit und Befreiung dargestellt werden. Der Realitäts- und Naturbezug (wie noch im Rokoko) wird durch die Verklärung und Überzeichnung von Gefühlen und Gefahren ersetzt, weshalb Romantiker oft verspottet und kritisiert wurden. (Delacroix, Caspar David Friedrich) | Stimmungen, Gefühle, Erlebnisse in romantischen Dichtungen (Schlegel, Novalis, Eichendorff, Brentano). | Wuchtige, gedrungene Bauten oft auch mit Rundbögen (Kathedralen in Mainz, Lübeck und Trier). |
| Realismus (1850-1920 in Frankreich) |
Der Begriff entstand durch Bilder des berühmten Malers Gustave Courbets (1819-1877) „Le Realisme“, die „Menschen bei der Arbeit“ zeigen. Für Courbets hat die „Kunst die Verpflichtung zur Wahrheit“. Der Realismus entstand daher als Gegenbewegung zur sinnlich verklärten Romantik und zeigt das echte, wahre (harte) Leben. | Wahrheitsgetreue Darstellung der Gegenwart durch objektive Abbildung. Die Realisten sahen in Menschen, Tieren und Natur nicht nur das Schöne und Gute, sondern auch das Böse und Hässliche – und meist im Wechselspiel von Licht und Schatten. (Rousseau, Corot, Millet) | Dorfgeschichten, Kriminal- und Gesellschafts-romane. (Dostojewski, Tolstoi, Fontane, Dickens, Ibsen). | Gründerzeit: (1850-1914). Riesige mit Glas überdachte Stahlbauten, oft Markthallen oder Bahnhöfe (Frankfurter Hauptbahnhof) |
| Impressionis-mus (1860-1900 in Frankreich) | Mit dem Impressionismus endet die „klassische Kunst“ und beginnt eine neue Welt mit einer neuartigen Sicht auf die Dinge. Gegenstand wird nicht in seinem objektiven Wesen, sondern in der subjektiven Erscheinungsform gesehen. |
Es war die Zeit der Freilichtmaler, die es (bei Wind und Wetter) hinaus in die freie Natur („en-plein-air“) zog, um vor Ort schnell wechselnde Lichtreflexe und fließende Bewegungen mit wildem Pinselstrich festhalten zu können. Dazu verwendeten sie oft hellere Farben und nahmen Linien und Konturen zurück. Beim Pointillismus (eine impressionistische Stilrichtung) übernehmen einzelne Farbpunkte die Führung, weshalb gemalte Gegenstände oft erst aus größerer Entfernung als das zu erkennen sind, was sie darstellen. (Monet, Liebermann, Renoir, Degas). |
Naturalismus: (1880-1900). Lyrik, Epik und Dramatik, die in der Wirklichkeit und Natur exakt beschrieben wird. (G. Hauptmann) | Jugendstil: (1890-1914). Schlanke Proportionen oft in asymetrischen Formen (La Sagrada Familia, Barcelona). |
| Expressionis-mus (1890-1914 in Deutschland) | Von den Malern der Künstlergruppen „Brücke“ (Gründung 1905 in Dresden) und „Der Blaue Reiter“ (1911 in München) bewusst gegen den Naturalismus und für den Ausdruck der eigenen Gefühle entwickelt. Der Begriff selbst wurde von Kurt Hiller geprägt. | Der Expressionismus ist Ausdruck des gesellschaftskritischen Protests. Die Maler distanzieren sich dabei von der bürgerlichen Ordnung und Vernunft. Ihre Motive bestechen oft durch eine gewisse Aggressivität und Intensität. Mit kräftigen Farben, Formen und Dynamik (bis in die Abstraktion) zeigten sie das Wilde und Archaische, dass in allen Menschen steckt. Dem deutschen Expressionismus steht der französische Fauvismus gegenüber. (Deutsche Maler: Erich Heckel, Franz Marc, Ernst Ludwig Kirchner, Wassiliy Kandinsky) | Figuren sind keine Charaktere mehr, sondern nur noch Typen; Visionen, Träume und Mystik werden grotesk beschrieben. (Heym, Rimbaud) | Backstein- und Betonbauten, oft mit runden und gezackten Formen (Einsteinturm in Potsdam; Chilehaus in Hamburg) |
| Kubismus (1906-1914 in Frankreich und Spanien) |
Die von Pablo Picasso und Georges Braque begründete Stilrichtung demontiert die Welt (und ihre Gegenstände) in Einzelteile und setzt sie in abstrakte Formen und Würfeln (frz. „cube“) neu zusammen. | Jedes Motiv wird in seine Teile zerlegt und in Formen wie Kegeln, Kugeln und Quadraten neu interpretiert und dargestellt. Fließende, harmonische Übergänge sucht man vergebens. Stattdessen setzen sich die Kubisten mit klaren Kanten und harten Linien über jede Regel der Kunst hinweg. (Berühmte Maler: Braque, Picasso, Duchamp) | Moderne: (1890-1920). Man besann sich wieder auf das „Ich“, die Individualität und die Subjektivität. (Hesse, Rilke) | Bauhaus: (1919-1933). Avantgarde der klassischen Moderne; Kunst- und Designschule von Walter Gropius 1919 in Weimar gegründet (1925 Umzug nach Dessau); Zusammenführung von Kunst und Handwerk; sachlich funktionale Architektur. (Wohnblöcke, Werkshallen) |
| Futurismus (1909-1945 in Mailand) |
Vom italienischen Schriftsteller Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) als avantgardistische Kunstbewegung gegründet. Sein Anliegen war der Bruch mit Traditionen und die Abbildung von Bewegung und Simultaneität (Gleichzeitigkeit). | Futuristen sind ausgesprochen „körperfeindlich“. Die Aktmalerei ist daher für sie widerwärtig und abstoßend. Sie widersetzen sich den Vertretern der klassischen Kunst und halten alles Überlieferte für suspekt. Ihre Formen und Farben stürzen zusammen, Dynamik und Ausstrahlung werden wichtiger. | Neue Sachlichkeit: (1920-1935): Literatur der Weimarer Republik. Romanform der Beobachtung. (Brecht, Kästner, Döblin) | Ein von Geschwindigkeit und Dynamik geprägter Baustil. |
| Dadaismus (1912-1922 in Zürich, Berlin, Paris, NYC) | Im Zürcher „Cabaret Voltaire“ von Hugo Ball, Hans Arp, Emmy Hennings, Marcel Janco und Tristan Tzara gegründet. Mit ihrer Stilrichtung brechen sie Tabus, setzen auf Provokation und Unlogik. Dada war auch eine „Anti-Kriegs-Bewegung“. | Absurdes, Banales und Provozierendes wird eingesetzt, um die konventionelle Kunst und Gesellschaft zu hinterfragen. Bestehende Werte und Normen werden ad absurdum geführt und durch Unsinn ersetzt. Alltagsgegenstände werden so plötzlich zu Kunstwerken. (Otto Dix, Grosz, Man Ray, Duchamp) | Radikale, destruktive und ablehnende Haltung gegenüber Krieg und Bürgerlichkeit.(Huelsenbeck, Franz Jung) | Art Deco: (1920-1939): geometrischer Stil mit Schmuck ohne Funktion. Heute noch gut in Florida-Beach erhalten. (Chrysler Building in New York City, USA) |
| Surrealismus (1920-1940 in Paris/NYC) | Der franz. Dichter und Schriftsteller André Breton (1896-1966) prägte den Begriff für diese Kunstepoche, die aus dem Dadaismus quasi als „Gegenwelt zur Wirklichkeit“ entstand. Es gibt keine Logik, die reale Welt und ihre Gegenstände verschmelzen (im wahrsten Sinne des Wortes) mit einer Traumwelt. | Aufdeckung von Träumen und des Unterbewusstseins. Die Wirklichkeit fließt hinüber in surrealistische Traumwelten. Tiefenpsychologische und phantasievolle Bilder (z.B. Uhren, die zerfließen) sprengen verkrustete Denkstrukturen. (Ernst, Dalí, Picasso, Magritte, Miró, Cocteau) | Beeinflusst von der Psychoanalyse ist der Traum handlungsauslösend und beschreibt die seelische Verfassung der Personen. (Breton, Freud) | Drehungen und Krümmungen werden durch den Eisenbetonbau möglich. (Schloss von Edward James in Xilitla) |
| Pop-Art (1955-1969) |
Pop-Art entstand unabhängig voneinander in Großbritannien und den USA. Die „popular art“ (beliebte Kunst) verbindet Kunst und Alltag. Sie macht sich über das intellektuelle Kunstverständnis vieler wohlhabender Kunstsammler lustig und wendet sich provokativ dem Trivialen zu. |
Alles wird zur Kunst: Reklameschilder, Comics, ja selbst triviale Gegenstände aus Konsum, Medien und Werbung (wie z.B. Konservendosen) werden zu Kunstobjekten. Diese werden aus dem ursprünglichem Kontext gerissen, isoliert und zu einem neuen, plakativen Design verändert. Einige Pop-Artisten verwenden dazu erstmals Siebdrucke, Collagen, seriellen Reihen und Graphiken. (Richard Hamilton, David Hockney, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Claes Oldenburg, James Rosenquist) |
Popliteratur: (1945-heute). Literarisches Aufbegehren gegen verkrustete Strukturen und Denkmuster. Thematisiert werden oft die Gefühle und das Handeln der jungen Generation. (Jack Keroua, Burroughs, von Stuckrad-Barre) |
Die Pop-Art-Kunstrichtung findet sich in Skulpturen, Objekte und Installationen wieder – selten aber in der klassischen Architektur. |
| Postmoderne (1957-1980) | Gegenbewegung zur sterilen und totalitären Form der Moderne. Vorhandene Ideen werden neu interpretiert. | Neuer Realismus: (ab 1960). Darstellung realer Gegenstände. Auf eine maltechnische Umsetzung wird weitest gehend verzichtet. Aktionskunst (künstlerische Performance), Minimalismus, Fluxus und Happenings sind weitere Kunstrichtungen und performative Ausdrucksformen der Postmoderne. Mit ihren Künstlern finden neue Medien wie Fotografie, Film oder Video Einzug in die Kunst. | Spielerischer Umgang mit Formen und Vorhandenem; Überwindung der Moderne durch extremen Pluralismus. | Reaktion auf Phantasielosigkeit; viele Gestaltungselemente. (Neue Pinakothek, München) |
Next Berühmte Maler
Back Allgemeinbildung Kunst
Oder Berühmte Malerinnen
Oder Deutsche Maler
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Wichtige Kunstepochen + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Kennen Sie noch weitere Kunstepochen, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Kunstepochen der Kunstgeschichte“:
Kunstsammelbände, Bücher über die verschiedenen Kunstepochen, Wikipedia, Kunstband, diverse Webseiten